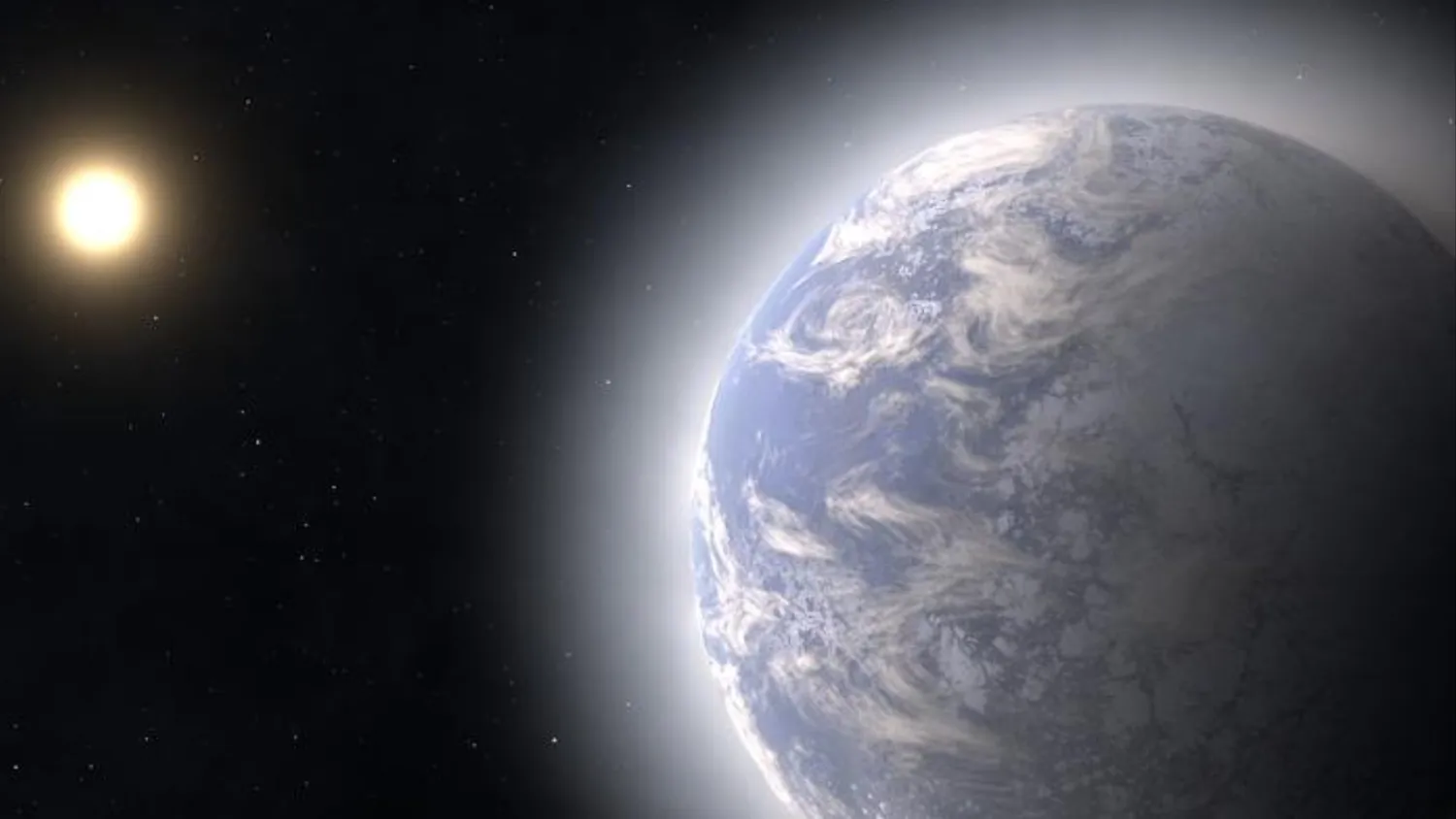Ist „Alien: Romulus“ überhaupt gut?(Bildnachweis: 20th Century Studios)
Es wurde immer als der perfekte Organismus angepriesen, ein tödliches Raubtier mit Säure als Blut, einem mächtigen zweiten Kiefer und – dank seines parasitären Lebenszyklus – einer Vorliebe für Körperhorror. Seit seinem Debüt in „Alien“ von 1979 ist Xenomorph XX121 ein ernsthafter Anwärter auf den Titel „größtes Monster der Filmgeschichte“, aber sein tödliches Erbe wird durch eine Flüssigkeit mit sehr seltsamen Eigenschaften getrübt.
Seit das Forschungsschiff Prometheus auf LV-223 gelandet ist – oder genauer gesagt, seit der Androide David Charlie Holloway einen Schuss in den Drink getan hat – wird die „Alien“-Saga von einer Substanz aufgehalten, die eher zähflüssig als bösartig ist. Dieser unwahrscheinlich vielseitige schwarze Schleim scheint mit jedem, den er berührt, etwas anderes zu machen, mehr eine erzählerische Bequemlichkeit als eine plausible Ergänzung der Mythologie der 45 Jahre alten Franchise. Jetzt, wo der magische Schleim in „Alien: Romulus“ wieder aufgetaucht ist, sieht es so aus, als würde er hier bleiben.
„Alien: Romulus“ – in der Zeitlinie der Franchise zwischen „Alien“ und „Aliens“ angesiedelt – ist ein solides Stück Sci-Fi-Weltraum-Horror, eine Rückkehr zur Spukhaus-im-Weltraum-Stimmung des Ridley Scott-Originals, mit einigen spannenden Kulissen und einer Ästhetik, die das klobige, analoge Design der ersten beiden Filme widerspiegelt. Ja, es ist im Grunde eine Neuauflage der größten Hits von „Alien“ und „Aliens“, aber wenn man sich schon irgendwo bedient, dann doch am besten bei den besten Alien-Filmen. Man kann sogar die exzessiven Anspielungen auf diese Filmklassiker verzeihen, denn so wie Michael Myers in der „Halloween“-Reihe immer noch Haddonfield terrorisieren kann, gibt es keinen Mangel an Möglichkeiten, wie ein Xenomorph den Zuschauer in Atem halten kann.

Die Originalbesatzung von „Alien“ (1979). (Bildnachweis: Brandywine Productions)Der Film „Prometheus“ aus dem Jahr 2012 war als Herkunftsgeschichte angelegt, in der erklärt wird, wie der sogenannte Space Jockey (auch bekannt als Ingenieur) an Bord eines Raumschiffs mit Facehugger-Eiern auf der Oberfläche von LV-426 landete. Es war auch ein ehrgeiziger Versuch, die „Alien“-Mythologie mit den Ursprüngen des Lebens auf der Erde zu verknüpfen und gleichzeitig zu erklären, wie das kultigste Star-Biest des Kinos entstanden ist. Natürlich ahnte niemand, dass die kanonische Evolution der Spezies untrennbar mit der Chemikalie A0-3959X.91 verbunden war – oder, wie wir es lieber nennen, mit schwarzem Glibber.
Leider ändern sich die Eigenschaften dieser Verbindung so häufig, dass es unmöglich ist, zu definieren, was sie wirklich ist. Ist es eine Waffe? Eine wichtige Zutat in der Ursuppe? Die Zukunft der menschlichen Ethnie? Alles von alledem? Nichts von alledem? Niemand scheint sich ganz sicher zu sein.
In der Eröffnungsszene von „Prometheus“ landet ein Ingenieur auf einer unbewohnten Welt – vermutlich der Erde – und trinkt einen Schuss Glibber. Sofort zerreißt es seinen Körper auf genetischer Ebene, und er löst sich in einem Wasserfall auf, um neues Leben zu säen.

Der Ingenieur in der Eröffnungssequenz von „Prometheus“ (2012). (Bildnachweis: 20th Century Studios)
Bei dem armen, unglücklichen Charlie Holloway führt es zu Übelkeit und extremen Hautreizungen, obwohl seine Metamorphose nie ihren Endpunkt erreicht, weil er sich mit einem Flammenwerfer verbrennen lässt. Nach der Infektion schläft er mit seiner Freundin Elizabeth Shaw, die – obwohl sie keine Kinder bekommen kann – schwanger wird. Ihr Nachwuchs ist jedoch alles andere als menschlich, und nach einem äußerst unangenehmen DIY-Kaiserschnitt bringt sie einen freakigen außerirdischen Tintenfisch zur Welt. Diese Kreatur wächst bis zum letzten Akt zu krakenartigen Ausmaßen heran und attackiert einen Ingenieur mit der ganzen Wucht eines riesigen Facehuggers. In der Schlussszene des Films bohrt sich eine sehr lose Annäherung an den klassischen Xenomorph – vom Produktionsteam als „Deacon“ bezeichnet – aus der Brust des Ingenieurs.
Der Glibber erzeugt auch den tödlichen Wurm, der den naiven Botaniker Millburn tötet und den Geologen Fifield in ein blutrünstiges Monster verwandelt, das über die rückenbrechenden gymnastischen Fähigkeiten von Regan in „Der Exorzist“ verfügt. Wir erfahren auch, dass das Ziel der Ingenieure für den Glibber die Erde war, wo er als Massenvernichtungswaffe eingesetzt werden sollte – unsere Schöpfer hatten offensichtlich ein ernstes Problem mit der menschlichen Ethnie.
Ein Jahrzehnt später stößt die Besatzung des Kolonieschiffs Covenant bei einem unerwarteten Abstecher zu „Planet 4“ auf eine neue Form des Glibbers. Er existiert nun in der Luft und ist klein genug, um über Ohr oder Mund eingeschleust zu werden, so dass das invasive Facehugger-Stadium überflüssig ist. Stattdessen reichen diese wenigen kleinen Samen aus, um einen ganzen Proto-Xenomorph im Inneren des unglücklichen Wirts zu erzeugen, der bereit ist, über die Wirbelsäule, den Mund oder jeden anderen Ausgang, den er (vermutlich) findet, auszubrechen. Wie anders wäre der ursprüngliche „Alien“ gewesen, wenn Kane den Parasiten auf LV-426 einfach inhaliert hätte.

Der mysteriöse schwarze Schleim in Aerosolform in „Alien: Covenant“ (2017). (Bildnachweis: 20th Century Studios)
Dieser phantastische Glibber ist in einem Sci-Fi-Universum, in dem Besatzungen für lange Reisen durch den Weltraum in den Winterschlaf gehen – hier gibt es keine relativitätsverletzenden Hyperantriebe – und das Leben auf anderen Planeten gefährlich und von Krankheiten durchsetzt ist, völlig fehl am Platz. Deshalb ist es auch so enttäuschend, dass eine Flüssigkeit mit scheinbar magischen Eigenschaften in „Alien: Romulus“ auftaucht, einem Film, der sich ansonsten an die geerdete Logik von „Alien“ und „Aliens“ hält.
In „Romulus“ setzt der neueste Company-Mann/Androide Rook ein wichtiges Thema der Franchise fort, indem er die Bedürfnisse des Megakonzerns Weyland-Yutani über die Opfer der Xenomorphs stellt. Es ist ihm gelungen, eine bestimmte „Nicht-Newtonsche Flüssigkeit“ (ja, der schwarze Glibber) aus dem Alien zu extrahieren, der die Nostromo verfolgte, und er ist fasziniert von der Fähigkeit dieser Substanz, die DNA eines Wirts umzuschreiben. Er plant, das von ihm synthetisierte „Compound Z-01“ zu verwenden, um die Menschen widerstandsfähiger gegen die Gefahren zu machen, die mit dem Aufbau besserer Welten verbunden sind – eine deutliche Abkehr von der üblichen Fixierung der Firma auf die Rekrutierung der Xenomorphs für ihre Biowaffenabteilung.
Sobald der Androide Andy vorschlägt, dass der von Rook synthetisierte Glibber der kranken Kay helfen könnte – schließlich hat er bei Ratten (irgendwie) funktioniert – ist es unvermeidlich, dass das Mittel in die Blutbahn eines der Überlebenden gelangt. Denk an Tschechows Pistole in ekligerer, glibberigerer Form…
Die Injektion führt zu einer weiteren ausgeprägten Nebenwirkung der Substanz, denn die schwangere Kay bringt den „Nachwuchs“ zur Welt. Dieser spindeldürre, schnell trächtige Riese vereint viele Attribute seiner Elternspezies – seine vage menschlichen Züge sind mit ätzendem Blut, einem Schwanz und einem zweiten Mund vermischt – doch ihm fehlt die tödliche Eleganz des ursprünglichen Xenomorphs. Ja, er ist überzeugender als der viel geschmähte „Newborn“ aus „Alien: Resurrection“, aber das ist eine schwache Phrase.

Ripley und Newt stellen sich der Königin in „Aliens“ (1986). (Bildnachweis: 20th Century Fox)
Im Gegensatz zu „Prometheus“, „Covenant“ und „Romulus“ bleiben einige entscheidende Schritte in der Entwicklung des Xenomorphs unbekannt. Hätte Regisseur Ridley Scott grünes Licht für seine geplante Fortsetzung von „Covenant“ erhalten, hätte der Einfluss des schwarzen Glibbers auf die Entwicklung der Kreatur die Lücken vielleicht gefüllt und ein befriedigenderes Ganzes ergeben – zumal „Covenant“ bereits enthüllt hat, wie der bösartige Androide David ein Jahrzehnt damit verbracht hat, den Glibber zu manipulieren, um seine eigene Vision von Perfektion zu schaffen. Vielleicht wäre eine detaillierte Erklärung, wie der Glibber tatsächlich funktioniert, Teil des aufgegebenen Drehbuchs gewesen.
Es ist fraglich, ob irgendeine Ergänzung der Mythologie die Saga wirklich bereichert hat, seit James Cameron die Königin in „Aliens“ eingeführt hat, obwohl der schwarze Glibber zu den fragwürdigsten Entscheidungen in der Geschichte der Franchise gehört. Dank des ikonischen Kreaturendesigns von H.R. Giger und der Brutalität des Lebenszyklus von Facehugger/Chestburster/Drone/Queen kam der Xenomorph in seiner vollen Form an, ohne dass es einer Hintergrundgeschichte – oder eines mystischen kosmischen Schlamms – bedurfte, um zu erklären, warum er tut, was er tut. Ash hatte Recht, als er diesen ikonischen interstellaren Bösewicht als den perfekten Organismus bezeichnete, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass bizarre nicht-newtonsche Flüssigkeiten ihm den Platz an der Spitze der filmischen Nahrungskette streitig machen können – hoffentlich fand der schwarze Glibber ein dauerhaftes (und angemessen klebriges) Ende in den Planetenringen über Jacksons Stern.
„Alien: Romulus“ ist jetzt in den Kinos. „Alien“, „Aliens“, „Alien 3“, „Alien: Resurrection“, „Alien vs Predator“, „Aliens vs Predator: Requiem“, ‚Prometheus‘ und ‚Alien: Covenant‘ sind auf Hulu in den USA und Disney Plus in Großbritannien verfügbar.