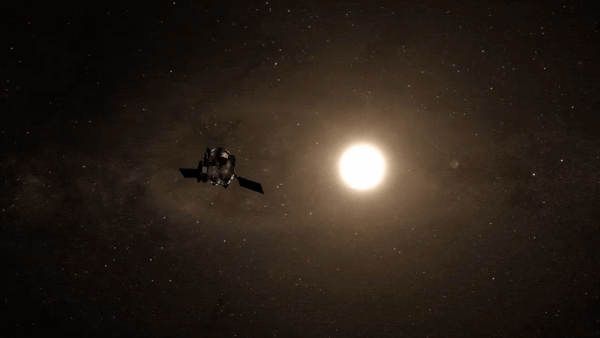Der kometenähnliche Proplyd 177-341 W ist eine planetenbildende Scheibe, die im Orionnebel verdampft.(Bildnachweis: ESO/M. L. Aru et al.)
Im Orionnebel befindet sich eine Vielzahl von bizarren, tropfenförmigen Objekten. Sie sehen aus wie seltsame Kometen, sind aber in Wirklichkeit verdampfende, planetenbildende Scheiben um junge Sterne. Die Astronomen sind verblüfft über die Existenz dieser Scheiben, denn sie hätten schon längst zerstört werden müssen.
Diese rätselhafte Natur macht sie jedoch zu verlockenden Zielen für Studien – und ein neues Bild, das vom Instrument Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) am Very Large Telescope in Chile aufgenommen wurde, hat genau das getan. Dieses Bild zeigt eines dieser merkwürdigen Objekte mit der Bezeichnung 177-341 W sehr hell.
Es handelt sich um einen Körper, der als Proplyd bezeichnet wird, ein Portmanteau von „ionisierte protoplanetare Scheibe“. Proplyds wurden erstmals Mitte der 1990er Jahre von Astronomen mit dem Hubble-Weltraumteleskop im 1.344 Lichtjahre entfernten Orionnebel entdeckt. Ihre planetenbildenden Scheiben werden durch starkes ultraviolettes Licht erodiert, das von massereichen Sternen im Nebel ausgestrahlt wird, vor allem von dem hellen und heißen Stern Theta-1 Orionis C. Dieser ist der herausragende der vier Hauptsterne, die das Trapezium bilden, den zentralen jungen Sternhaufen im Herzen des Orionnebels.
Theta-1 Ori C ist so massereich (33-mal so schwer wie unsere Sonne), dass er zur heißesten Klasse von Sternen gehört, den O-Typ-Sternen im Hertzsprung-Russell-Diagramm der Sternentwicklung. Außerdem leuchtet er 204.000-mal heller als unsere Sonne, was bedeutet, dass er verdammt viel ultraviolette Strahlung erzeugt, die alles im Umkreis von Lichtjahren ionisiert. Proplyds sind die unglücklichen jungen Planetensysteme, die dieser ultravioletten Strahlung in die Quere kommen.
Auf dem MUSE-Bild von 177-341 W ist der helle Bogen oder die Spitze des Ausläufers der Ort, an dem der starke Strom ultravioletter Strahlung von Theta-1 Ori C auf den sanfteren Sternwind trifft, der vom Stern im Herzen von 177-341 W ausgeht.
Diese ultraviolette Strahlung erwärmt auch die Oberfläche der sich bildenden Gas- und Staubscheibe, und wenn sich die Gase auf der Oberfläche der Scheibe erwärmen, dehnen sie sich aus und werden vom Strom der ultravioletten Strahlung mitgerissen. Auf diese Weise entsteht der kometenähnliche „Schweif“ des Proplyd, der dem Theta-1 Ori C diametral entgegengesetzt ist (er liegt außerhalb des Bildes hinter der rechten oberen Ecke).
Abonnieren Sie den kosmischeweiten.de Newsletter
Brennende Weltraumnachrichten, die neuesten Updates zu Raketenstarts, Himmelsbeobachtungsevents und mehr!
Mit der Übermittlung Ihrer Daten erklären Sie sich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden und sind mindestens 16 Jahre alt.
Im Orionnebel wurden bisher insgesamt 178 Proplyden entdeckt. Das ist ein möglicher Hinweis auf die Geburt von 178 Planetensystemen, die über die bereits entstandenen hinausgehen. Wir sagen „potenziell“, weil es einen großen Vorbehalt gibt: das Proplyd-Lifetime-Problem.

Der Orionnebel, Heimat von 178 Proplyden, darunter 177-341 W. (Bildnachweis: ESO/G. Beccari)
Durch die ultraviolette Strahlung wird Material aus den Scheiben herausgezogen, aus dem sich sonst Planeten bilden würden, und die Scheiben verlieren an Masse. Da das Alter des Orionnebels zwischen 2 und 3 Millionen Jahren liegt, sollte also genügend Zeit vorhanden gewesen sein, um die Proplyds vollständig zu verdampfen und die Bildung wesentlicher Planetensysteme zu verhindern. Im extremsten Fall sollte Theta-1 Ori C die Entstehung von Planeten überhaupt verhindern! Und doch sehen wir die Proplyds immer noch. Ist unsere Schätzung, wie viel Masse sie verlieren, falsch?
Ein Team von Astronomen unter der Leitung von Mari-Lilis Aru von der Europäischen Südsternwarte nutzte die MUSE-Beobachtungen von 12 Ausläufern im Orionnebel, darunter 177-341 W, um diese Frage zu beantworten. Sie fanden heraus, dass die Proplyden mit Raten zwischen 1,07 und 94,5 x 10-7 Sonnenmassen an Masse verlieren – mit anderen Worten: zwischen 10 Millionstel und 945 Millionstel der Sonnenmasse pro Jahr. Dies stimmt mit früheren Schätzungen der Masseverlustrate überein. Und bei dieser Geschwindigkeit müssten die Proplyds bereits verdampft sein. Wir sollten sie nicht mehr sehen können.
Das Rätsel bleibt also bestehen, und die Proplyds werden auch in den kommenden Jahren Gegenstand intensiver Beobachtungen und Debatten sein, da die Forscher versuchen werden, herauszufinden, was es ihnen ermöglicht, angesichts der starken ultravioletten Strahlung zu überleben und Planeten zu bilden.
Die Ergebnisse des Teams von Aru werden in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht. Ein Vorabdruck ihrer Arbeit ist online verfügbar.