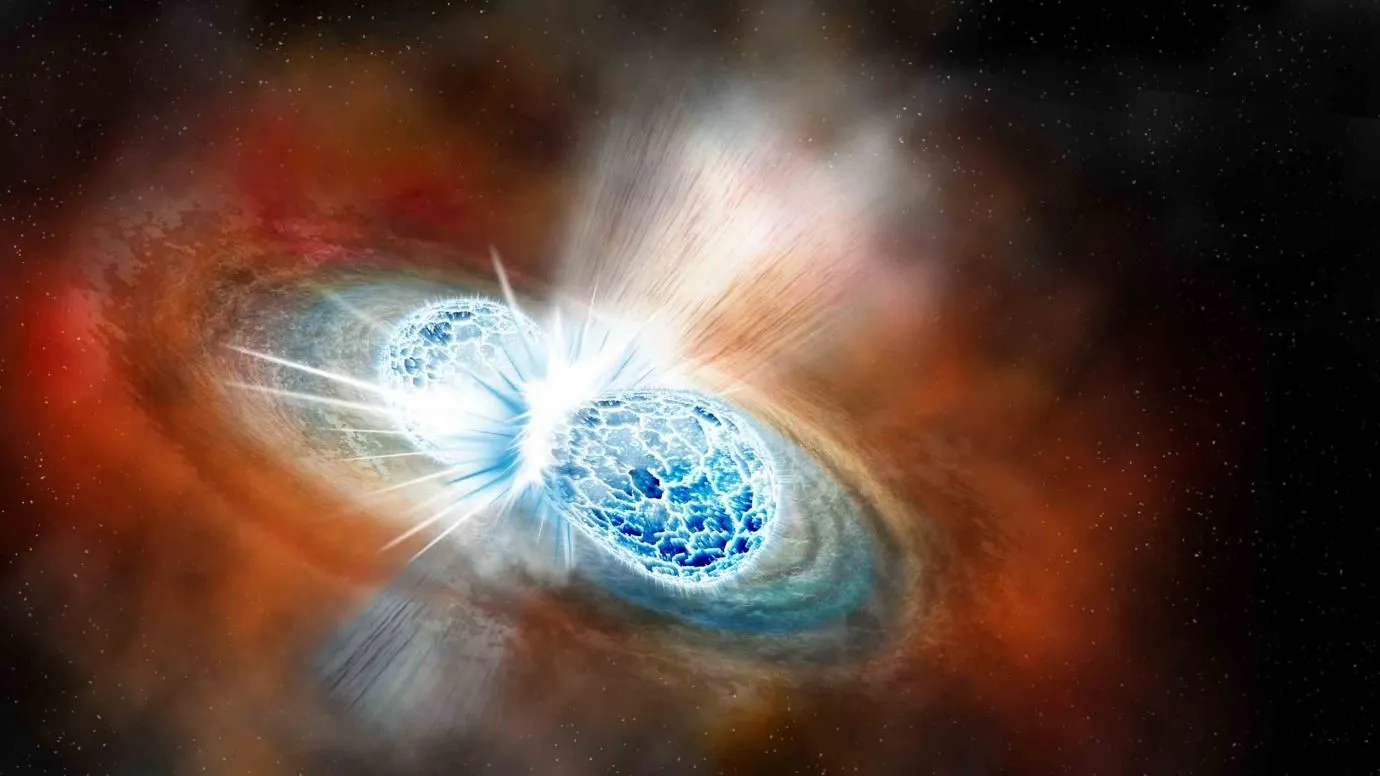Illustration unserer Galaxie, der Milchstraße, schräg gesehen, mit den Armen und dem zentralen Balken an ihren ungefähren bekannten Positionen.(Bildnachweis: Mark Garlick/Science Photo Library/Getty Images)
Illustration unserer Galaxie, der Milchstraße, schräg gesehen, mit den Armen und dem zentralen Balken an ihren ungefähren bekannten Positionen.(Bildnachweis: Mark Garlick/Science Photo Library/Getty Images)
Obwohl unsere Teleskope einige wirklich atemberaubende Bilder der Milchstraße eingefangen haben, haben die Astronomen nur eine vage Vorstellung von unserer Heimatgalaxie. Es hat viel Arbeit gekostet, diese Skizze zu erstellen, und es ist erstaunlich, was wir aus unserem begrenzten Blickwinkel lernen konnten.
Hier auf der Erdoberfläche erscheint die Milchstraße mit bloßem Auge als nebliges Band am Himmel. Während Astronomen und Philosophen seit Jahrhunderten über die wahre Natur und Lage der Milchstraße debattieren, war der große Astronom, Physiker und Universalgenie Galileo Galilei der erste, der die wahre Natur der Galaxie entdeckte: unzählige Sterne, die so klein sind, dass sich ihr Licht vermischt. Mitte des 17. Jahrhunderts stellte der Philosoph Immanuel Kant die richtige Vermutung auf, dass die Milchstraße eine rotierende Scheibe aus Sternen ist, und da wir in diese Scheibe eingebettet sind, erscheint sie uns als Band. Einige Jahrzehnte später versuchte der Astronom William Herschel, eine Karte des Universums zu erstellen – mit wenig Erfolg.
Erst in den frühen 1900er Jahren begannen wir, die wahre Natur unserer Galaxie zu entschlüsseln. Damals entdeckte der Astronom Edwin Hubble, dass es sich beim Andromedanebel tatsächlich um die Andromedagalaxie handelte, ein „Inseluniversum“, das Millionen von Lichtjahren von uns entfernt ist. Die Milchstraße war nicht nur eine Scheibe aus nahen Sternen. Sie bildete den Hauptteil unserer eigenen Galaxie, weshalb unsere Galaxie den Namen dieser bekannten Himmelserscheinung annahm.
Beobachtungen anderer Galaxien halfen uns dabei, herauszufinden, wie unsere Heimatgalaxie aussah. Die meisten Scheibengalaxien weisen Spiralarme und eine dichte zentrale Ausbuchtung auf, so dass es naheliegend ist anzunehmen, dass auch die Milchstraße diese Merkmale aufweist. Doch die direkte Kartierung der Milchstraße ist eine äußerst schwierige Aufgabe. Zum einen ist sie sehr groß – etwa 100.000 Lichtjahre an ihrer breitesten Stelle. Und in ihrem Inneren gibt es eine Menge Zeug – zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne, Hunderttausende von Sternentstehungsgebieten und unzählige Planeten, schwarze Löcher, Neutronensterne und vieles mehr. Die Durchmusterung selbst kleiner Teile der Milchstraße erfordert also enorme Ressourcen.
Und dann ist da noch der Staub. Staub, der sich im interstellaren Raum befindet, hat die unangenehme Eigenschaft, das Licht zu trüben und zu streuen. Da wir in die Milchstraße eingebettet sind, wird unsere Sicht umso mehr durch Staub verdeckt, je weiter wir zu schauen versuchen. Selbst die leistungsstärksten Teleskope der Welt können die Regionen auf der gegenüberliegenden Seite der Galaxie nicht direkt untersuchen.
 Ein Arm der Milchstraße, wie er am Nachthimmel zu sehen ist. (Bildnachweis: Getty Images)
Ein Arm der Milchstraße, wie er am Nachthimmel zu sehen ist. (Bildnachweis: Getty Images)
Um die Milchstraße zu kartieren, nutzen die Forscher also viele verschiedene Beobachtungen und kombinieren diese mit Vergleichen mit anderen Galaxien und cleveren theoretischen Modellen, um ein vollständiges Bild zu erstellen.
Beispielsweise umkreisen Kugelsternhaufen das Zentrum der Milchstraße in einer annähernd kugelförmigen Anordnung. Wenn wir ihre Positionen im dreidimensionalen Raum aufzeichnen, können wir herausfinden, wo sich das Zentrum befindet – etwa 25.000 Lichtjahre von uns entfernt.
Wir können auch die Bewegungen der Sterne untersuchen, wenn sie das Zentrum umkreisen, und unser Verständnis der Schwerkraft nutzen, um zu modellieren, wie der Kern aussehen muss. Dank dieser Technik glauben wir, dass unsere Galaxie eine „Balkenspirale“ ist – der Kern ist länglich und vielleicht sogar erdnussförmig. Dies wird durch Beobachtungen bestätigt, die zeigen, dass eine bestimmte Art von roten Riesensternen, die sich in der Nähe des Kerns befindet, in zwei Populationen aufgeteilt ist und dass das vom Kern kommende Infrarotlicht nicht symmetrisch ist.
Die 2013 gestartete Raumsonde Gaia hat eine Hauptaufgabe: Sie soll so viele Sterne wie möglich katalogisieren und ihre Entfernungen, Bewegungen, Helligkeit und Farben aufzeichnen. Bis heute hat diese Mission fast 2 Milliarden Sterne katalogisiert, was zwar beeindruckend ist, aber dennoch nur etwa 1 % aller Sterne in der Milchstraße ausmacht.
Dennoch bietet dies den Astronomen einen enormen Fundus an Informationen über unseren lokalen Teil der Galaxie. Diese Daten liefern nicht nur eine genaue Karte unserer galaktischen Nachbarschaft, sondern können auch als Grundlage für den Vergleich und die Gegenüberstellung mit anderen, viel engeren, aber tieferen Durchmusterungen verwendet werden, um nach verdächtigen Merkmalen zu suchen, die uns helfen könnten, eine Karte der größeren Galaxie zu erstellen.
Nehmen wir die Spiralarme. Trotz ihres dramatischen Aussehens sind sie nur etwa 10 % dichter als ihre Umgebung. Stattdessen sind sie optisch auffällig, weil sie Regionen mit aktiver Sternentstehung sind, in denen viele neu entstandene, große und helle Sterne zu finden sind. Da wir eine detaillierte Karte unserer lokalen Galaxie haben, in der die Sternentstehung nicht so aktiv ist, können wir nach höheren Konzentrationen von Sternentstehung suchen, um die Spiralarme zu skizzieren.
Durch diese Techniken wissen wir, dass die Milchstraße mindestens zwei ausgeprägte Spiralarme hat, die auf einem zentralen stab- oder erdnussartigen Kern in Form eines riesigen S verankert sind. Darüber hinaus sind die Dinge jedoch ein wenig unklarer. Die Galaxie könnte zwei zusätzliche Arme mittlerer Intensität haben oder einfach nur ein Wirrwarr von Ausläufern und Verzweigungen. Jede „Karte“, die Sie von der Milchstraße sehen, ist hauptsächlich eine Vermutung und wird sich wahrscheinlich alle paar Jahre ändern, wenn wir unsere Techniken verbessern und ein besseres Verständnis erlangen.