
Ein Bild des Supernova-Überrests Cassiopeia A, das Daten der NASA-Weltraumteleskope Chandra, James Webb, Hubble und Spitzer kombiniert (Bildnachweis: Röntgen: NASA/CXC/SAO; Optisch: NASA/ESA/STScI; IR: NASA/ESA/CSA/STScI/Milisavljevic et al., NASA/JPL/CalTech; Bildverarbeitung: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt und K. Arcand)
Wissenschaftler haben ein seltenes Sternenstaubteilchen entdeckt, das aus dem explosiven Supernova-Tod eines fernen Sterns stammt. Dieses Teilchen scheint in einem alten Meteoriten eingeschlossen zu sein.
Das Staubkorn ist zwar klein, kann aber dazu beitragen, eine Geschichte über das Leben, den Tod und die Wiedergeburt von Sternen zu erzählen, die fast die gesamte 13,8 Milliarden Jahre alte Geschichte des Kosmos umspannt. Es könnte den Wissenschaftlern auch ermöglichen, die Geheimnisse eines kürzlich entdeckten Sterntyps zu entschlüsseln, der in einer einzigartigen Supernova-Explosion stirbt.
„Diese Partikel sind wie himmlische Zeitkapseln, die eine Momentaufnahme des Lebens ihres Muttersterns liefern“, sagte der Leiter des Forschungsteams und Wissenschaftler des Lunar and Planetary Science Institute in einer Erklärung.
Inhaltsübersicht
Eine stellare Geschichte von Tod und Wiedergeburt
Die meisten Meteoriten sind wie Zeitkapseln, die den Wissenschaftlern Aufschluss über das Material geben, das vor etwa 4,6 Milliarden Jahren im Sonnensystem vorhanden war, als die Sonne noch ein kleiner Stern war, der von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben war, die als „protoplanetare Scheibe“ bezeichnet wird.
Übermäßig dichte Bereiche dieses Gases und Staubs sind unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammengebrochen und haben weiter Material angesammelt, was schließlich zu Planeten wie der Erde und der Entstehung des Sonnensystems, wie wir es heute kennen, geführt hat. Das Material, das bei der Geburt der Planeten übrig geblieben wäre, wäre in Asteroiden und Kometen integriert worden.
Das frühe Sonnensystem war ein gewalttätiger und chaotischer Ort. Asteroiden und Kometen prallten auf die Erde und andere Planeten und krachten sogar ineinander. Fragmente, die bei diesem frühen kosmischen Demolition-Derby entstanden, regneten auch auf unseren Planeten herab; dies geschieht in manchen Fällen noch heute und stellt eine kosmische „Fossilaufzeichnung“ des frühen Sonnensystems dar.
Erhalten Sie den kosmischeweiten.de Newsletter
Brennende Weltraumnachrichten, die neuesten Updates zu Raketenstarts, Himmelsbeobachtungsevents und mehr!
Mit der Übermittlung Ihrer Daten erklären Sie sich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden und sind mindestens 16 Jahre alt.
Doch es bestand schon immer die Möglichkeit, dass das in alten Meteoriten eingeschlossene Material eine viel ältere Geschichte erzählen könnte, eine Geschichte nicht der Schöpfung, sondern der Zerstörung.

Eine Illustration des frühen Sonnensystems, als sich die Planeten und andere Objekte zu bilden begannen. (Bildnachweis: NASA)
Wenn Sterne, die vor der Sonne existierten, in gewaltigen Supernova-Explosionen starben, wurde das Material, das diese stellaren Körper im Laufe ihres Lebens geschmiedet hatten, im gesamten Universum verteilt.
Ein Teil dieser Materie fand unweigerlich seinen Weg in die nächste Generation von Sternen und in die protoplanetaren Scheiben um sie herum. Es ist jedoch eine Herausforderung, dieses gebrauchte Material von anderen Arten kosmischen Materials zu unterscheiden. Nevill und sein Team versuchten, dies zu erreichen, indem sie nach ungewöhnlichen Versionen oder „Isotopen“ bekannter chemischer Elemente suchten.
„Material, das in unserem Sonnensystem entstanden ist, hat ein vorhersagbares Verhältnis von Isotopen – Varianten von Elementen mit unterschiedlicher Neutronenzahl“, erklärte Nevill. „Das Teilchen, das wir analysiert haben, hat ein Verhältnis von Magnesiumisotopen, das sich von allen anderen in unserem Sonnensystem unterscheidet.“
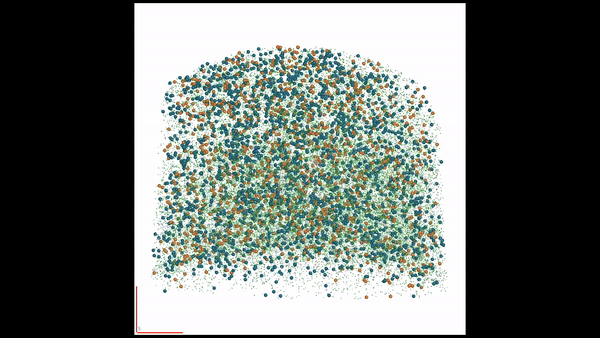
Eine dreidimensionale „Atomkarte“ zeigt zwei Arten von Magnesiumisotopen, die in der Meteoritenprobe entdeckt wurden. (Bildnachweis: Dr. David Saxey, Geoscience Atom Probe Facility, Curtin University).
Die extremen Ergebnisse dieser Analyse haben das Team überrascht.
„Die Ergebnisse sind buchstäblich aus dem Rahmen gefallen“, so Nevill. „Das extremste Magnesium-Isotopenverhältnis aus früheren Untersuchungen präsolarer Körner lag bei etwa 1.200. Das Korn in unserer Studie hat einen Wert von 3.025, was der höchste jemals entdeckte ist.“
Er glaubt, dass dieses außergewöhnlich hohe Isotopenverhältnis darauf hinweist, dass der Stern, der dieses Korn in die Region des Weltraums schickte, die eines Tages das Sonnensystem beherbergen würde, bei einem kürzlich entdeckten Ereignis starb: Eine wasserstoffverbrennende Supernova.
Wasserstoffverbrennende Supernovas treten auf, wenn massereiche Sterne mit Wasserstoffresten in ihrer äußeren Schicht (nachdem ihre Wasserstoffvorräte in ihren Kernen erschöpft sind) explodieren. Dies führt zu einer schnellen Verbrennung dieses verbleibenden Wasserstoffs.
„Die Atomsonde hat uns eine ganze Reihe von Details geliefert, zu denen wir in früheren Studien nicht in der Lage waren“, sagte David Saxey, Mitglied des Teams und Wissenschaftler an der Curtin University. „Die wasserstoffverbrennende Supernova ist ein Sterntyp, der erst kürzlich entdeckt wurde, etwa zur gleichen Zeit, als wir das winzige Staubteilchen analysierten.
„Die Verwendung der Atomsonde in dieser Studie gibt uns eine neue Ebene von Details, die uns helfen zu verstehen, wie diese Sterne entstanden sind.“
Teammitglied und Forscher an der Curtin University School of Earth and Planetary Sciences, Phil Bland, bemerkte, dass diese Ergebnisse zeigen, wie seltene Partikel in Meteoriten Wissenschaftlern einen Einblick in Ereignisse gewähren können, die weit jenseits der Grenzen des Sonnensystems stattfinden.
„Es ist einfach erstaunlich, dass wir in der Lage sind, Messungen auf atomarer Ebene im Labor mit einem kürzlich entdeckten Sterntyp zu verbinden“, schloss er.
Die Forschungsergebnisse des Teams wurden am Mittwoch (27. März) in der Zeitschrift Astrophysical Journal veröffentlicht.




