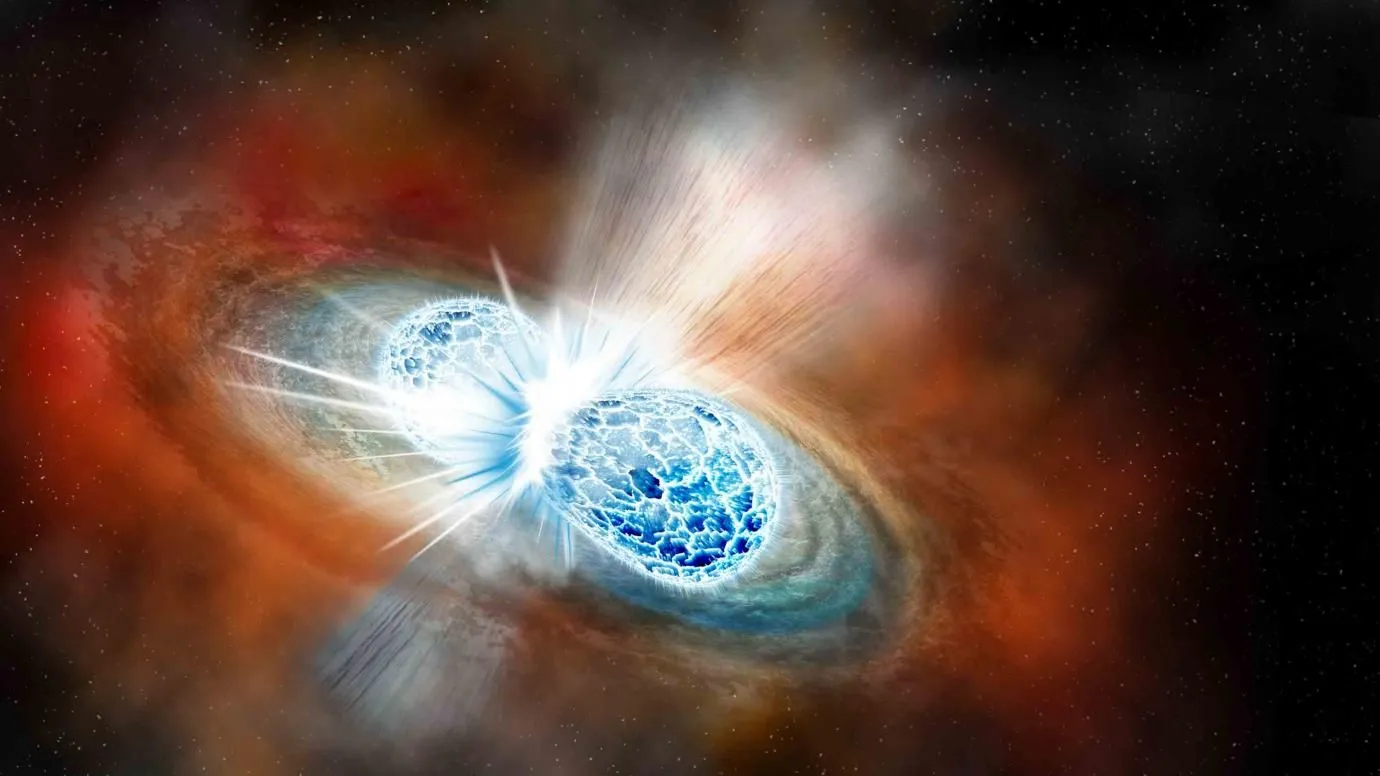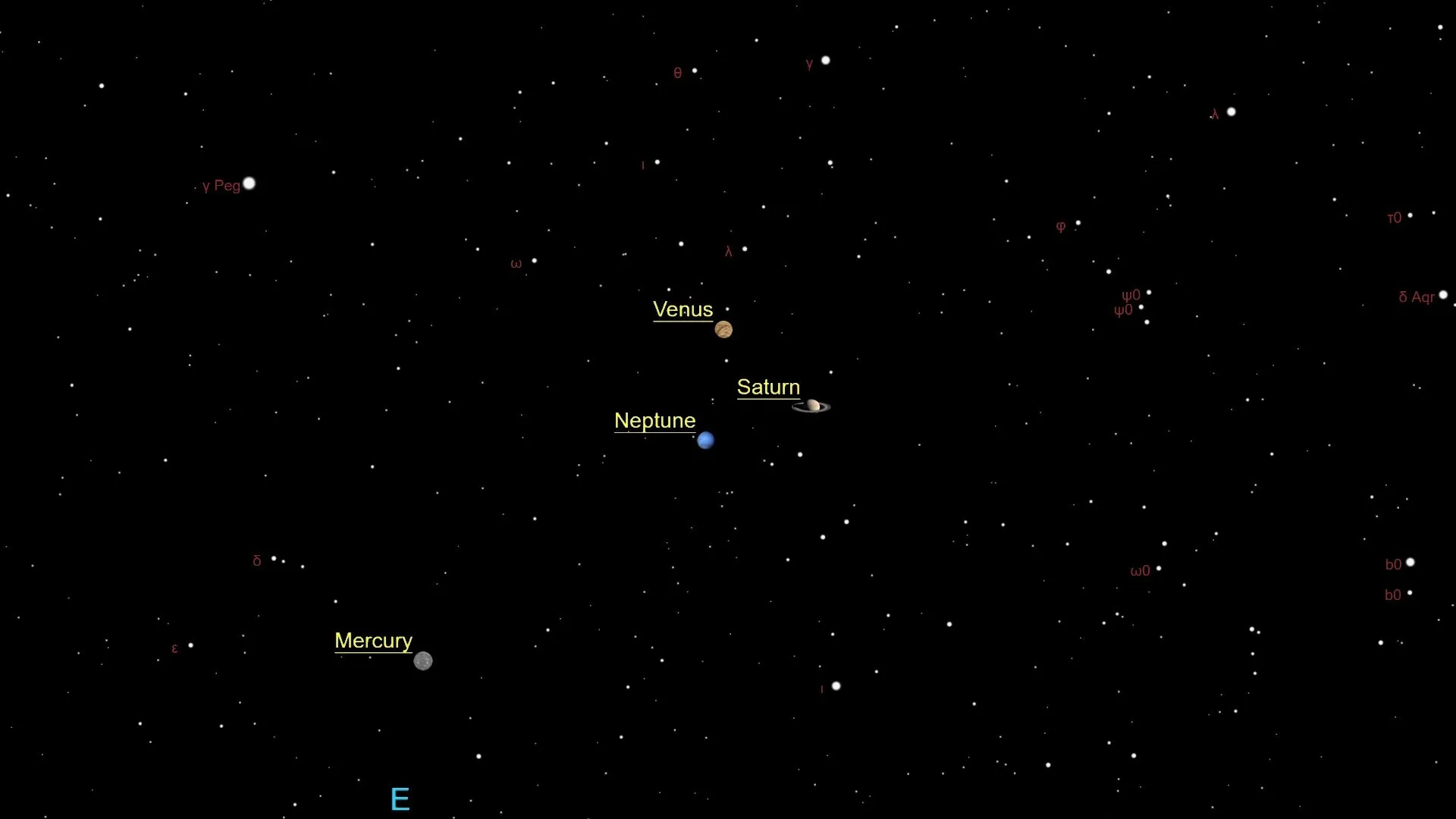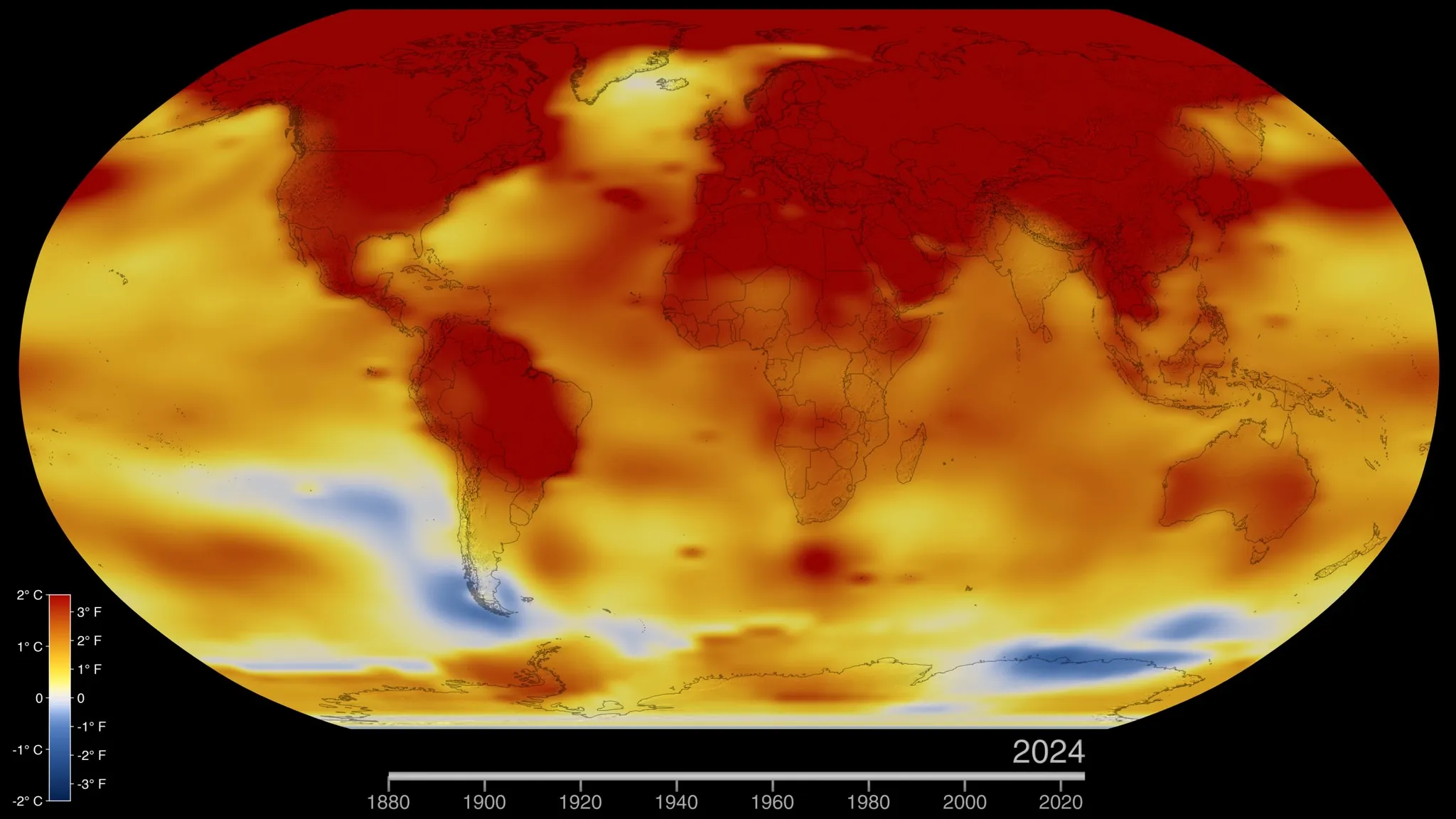Röntgenstrahlen des Chandra-Röntgenobservatoriums der NASA (violett) und Infrarotdaten des James-Webb-Weltraumteleskops der NASA (rot, grün, blau) zeigen UHZ1, die Heimat eines gigantischen Schwarzen Lochs, das existierte, als das Universum erst 470 Millionen Jahre alt war. (Bildnachweis: Röntgen: NASA/CXC/SAO/Ákos Bogdán; Infrarot: NASA/ESA/CSA/STScI; Bildverarbeitung: NASA/CXC/SAO/L. Frattare & K. Arcand)
Ein riesiges schwarzes Loch in der Frühzeit des Universums ist viel größer als es für sein Alter sein sollte, wenn man von dem ausgeht, was wir über die Entstehung schwarzer Löcher wissen. Könnte es also einen anderen Weg geben, schwarze Löcher zu erzeugen?
Im Jahr 2023 entdeckten Astronomen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) und dem Chandra-Röntgenobservatorium UHZ1, die Heimat eines gigantischen schwarzen Lochs, das existierte, als das Universum erst 470 Millionen Jahre alt war.
Das Schwarze Loch von UHZ1 wiegt etwa 40 Millionen Sonnenmassen. Das ist zwar viel kleiner als die größten entdeckten supermassiven schwarzen Löcher, aber immer noch ein gewaltiger Wert, wenn man bedenkt, wie früh in der Geschichte des Universums es entstanden ist.
Tatsächlich ist es zu groß. Die einzige bekannte Möglichkeit, Schwarze Löcher zu erzeugen, ist das Sterben von massereichen Sternen. Wenn große Sterne sterben, hinterlassen sie schwarze Löcher, die bis zu ein paar Dutzend Mal so groß sind wie die Sonne. Von dort aus können sie durch Verschmelzung mit anderen Schwarzen Löchern und durch Anreicherung mit Material aus ihrer Umgebung zu gigantischen Ausmaßen anwachsen.
All das ist schön und gut, aber das Problem mit UHZ1 – und einigen seiner Freunde – ist, dass nicht genug Zeit zur Verfügung steht, um von kleinen Samen zu supermassiven Monstern zu werden. Das Wachstum von Schwarzen Löchern wird durch die so genannte Eddington-Rate begrenzt. Wenn Material in ein Schwarzes Loch fällt, wird es komprimiert, erhitzt sich und gibt Strahlung ab. Diese Strahlung verhindert, dass weiteres Material zu schnell hineinfällt; sie wirkt wie ein natürliches Ventil, das jedes Schwarze Loch auf eine langsame und gleichmäßige Diät setzt.
Damit UHZ1 aus einem stellarmassen Schwarzen Loch entstehen kann, müsste es schneller Material akkretieren, als es die Eddington-Rate erlaubt. Obwohl es in bestimmten Fällen möglich ist, die Eddington-Grenze zu durchbrechen, müsste es dieses Tempo über 100 Millionen Jahre lang beibehalten, was die Glaubwürdigkeit beeinträchtigt.
Vielleicht wurde UHZ1 also nicht durch den Tod eines Sterns geboren. Vielleicht ist etwas Größeres von selbst kollabiert, um einen ausreichend großen Keim zu schaffen, der in kurzer Zeit zur Supermasse heranwachsen konnte.
Aber das frühe Universum war nicht gerade ein komplizierter Ort. Es gab keine Sterne, Galaxien oder gar schwere Elemente. Es gab nur riesige Wolken aus reinem Wasserstoff und Helium, die sich langsam und stetig zu dem reichhaltigen Wandteppich des heutigen Kosmos entwickelten.
Astrophysiker erkannten, dass es möglich sein könnte, dass diese riesigen Gaswolken von selbst zusammenbrechen. Der Trick besteht darin, sie warm genug zu halten. Wenn sie zu schnell abkühlen, kollabieren sie nicht als monolithische Einheit, sondern zersplittern in viele kleinere Taschen und produzieren eine Reihe von Sternen normaler Größe.
Elemente, die schwerer als Helium sind und im Astronomiejargon als „Metalle“ bezeichnet werden, sind sehr effizient bei der Abkühlung von Gaswolken, da sie Strahlung bei einer Vielzahl von Wellenlängen aussenden können. Im frühen Universum gibt es diese jedoch nicht. Auch molekularer Wasserstoff kann diesen Trick anwenden. Wenn jedoch genügend ultraviolette Strahlung (UV) um diese Gaswolken herum strahlt, werden die Moleküle aufgebrochen und der Wasserstoff bleibt in seinem atomaren Zustand.
Wenn die Bedingungen stimmen, kollabiert die Gaswolke zu einem gigantischen, sternähnlichen Gebilde, das über 10.000 Sonnenmassen wiegen kann. In ihrem Kern bildet sich sofort ein schwarzes Loch, das dann das umgebende Material ansaugt und schnell auf eine Masse von mehr als dem 1000- oder sogar 10.000-fachen der Sonnenmasse anschwillt.
Aber es gibt ein Problem: Wir wissen nicht, wie man im frühen Universum so viel UV-Strahlung erzeugen konnte. Die praktischste Quelle für UV-Strahlung sind Sterne, die aber knapp sind … vor dem Auftreten von Sternen.
In den letzten Jahren haben Astrophysiker eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, wie die Wasserstoffgaswolken aufgeheizt werden könnten. Einige Ideen beruhen auf den ersten Sternen in der kosmischen Morgendämmerung, die nahe gelegene Klumpen aufheizen. Andere sind exotischer und stützen sich auf hypothetische Formen dunkler Materie, die sich in den frühen, berauschenden Tagen des Universums in Strahlung umwandeln könnte.
Letztendlich sind wir nicht sicher, wie riesige Schwarze Löcher im frühen Universum so groß geworden sind. Es könnte ein direkter Kollaps sein, es könnte ein exotischer Prozess sein, es könnte etwas sein, was wir noch nicht herausgefunden haben. Aber genau deshalb sind Instrumente wie das JWST so nützlich: Sie geben Rätsel auf, aber sie helfen hoffentlich auch, diese Rätsel zu lösen.